|
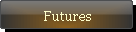
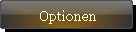
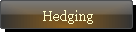

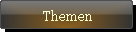

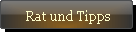
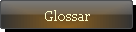
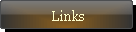
| |
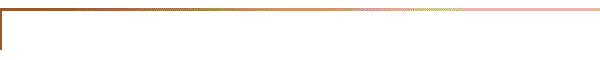

|
Rechtlich
ebenso treffend wie schulgerecht umschrieben stellt ein Terminkontraktgeschäft
= Futures-Kontrakt ("contract for future delivery",
"futures contract" oder kurz "Futures";
aus dem Englischen "future", »Zukunft« übernommen; "Zukunftskontrakt")
eine freie, wechselseitig bindende rechtsgültige Vereinbarung zwischen
zwei Vertragsparteien des Inhaltes vor, welcher den folgenden Anforderungen
und Vorschriften einer Börse in vollem Umfang Genüge leistet:
 |
einen nach seiner Beschaffenheit genau definierten Vertragsgegenstand,
den sogenannten Basisgegenstand
("underlying"), wie namentlich Waren bestimmter Sorten oder
Qualitätsmuster, Devisen, Aktien- und Aktienindizes, ausgewählte
Zinstitel oder sonstige Verfügungsrechte es sind,
|
 |
in einer ganz bestimmten
Quantität
(d.
i. eine fertig vorgegebene
Menge an vertretbaren Sachen bzw. ein fertig verzeichneter
Nominalwert an einem Finanzinstrument), welche den Kontraktumfang
bildet (Schlusseinheit, Einheitssatz, "Kontraktvolumen",
Terminkontraktbetrag),
|
 |
auf
einen festbestimmten zukünftigen
Zeitpunkt
oder auf eine festbestimmte
Abfertigungsfrist
(Liefertermin, Liquidationstag oder kurz "Termin"),
|
 |
zu einem
zum Termin festgesetzten
Preis
(Kontraktpreis zum Termin, Endabrechnungspreis), der
sich von dem an der Börse zweiseitig ausgehandelten
Terminkontrakt-Preis
laufend fortschreibt (Futureskurs, Futures-Preis,
Terminkurs; Abschlusspreis, Referenzpreis),
|
an einem börslich festgelegten Bestimmungsort
("delivery location") zu überliefern (Verkauf des Futures
= Short-Futures) bzw. zu übernehmen und zu bezahlen (Kauf
des Futures = Long-Futures) oder, wenn nötig, statt Vollzug der
physischen Belieferung einen
Wertausgleich*
vorzunehmen.
[* Das Schlussverfahren
des Barausgleichs hat im Zuge der Endabwicklung des Geschäfts die Abgeltung
des Vorteils aus dem jeweils höherwertigen Einzelposten zum Zweck. Als
Wertausgleich oder
Barausgleich ("cash settlement")
bezeichnet man demgemäß einen an die Gegenpartei eines im Wert gestiegenen
Termingeschäfts gerichteten Ausgleichsanspruch in barem Geld. Der Wertzuwachs
eines Futures rührt her aus dem Unterschied seines Abschlusspreises
gegen den maßgebenden Regulierungspreis des Fälligkeitsstichtages. Die
Plusdifferenz ist demjenigen zu vergüten, zu dessen Gunsten sie sich
herausbildet.]
Futures fallen nach der obigen Ausdeutung
nicht unter den Wertpapierbegriff, sondern prägen sich in börsenfertigen
Verträgen, den Futures-Kontrakten aus. Futures sind auf die Zukunft
abstellende, d.h. an einen
bestimmten Termin geknüpfte normierte wirtschaftswertige Verträge
(terminierte Finanzkontrakte, Termingeschäfte i.e.S.;
allg.: Verfügungsrechte aus Zeitgeschäften), die nach einheitlichem
Muster in gleichmäßiger Form an spezialisierten Börsen: den
Terminbörsen, ausgehandelt,
notiert und über eine besondere Verrechnungsstelle der Terminbörse (Clearingstelle)
aufgerechnet und abgewickelt werden ("Börsenterminkontrakt"). Im Unterschied
zu den einzeln vereinbarten Termingeschäften
(Zeitgeschäfte, besonders Lieferungsgeschäfte, namentlich
sog. Forwards bis hin zu Forward Rate Agreements FRAs),
aus denen sie sich entwicklungsgeschichtlich herausgebildet haben, bleibt
die persönliche Identität der einzelnen Marktteilnehmer im börslichen
Handelsverkehr mit Futures zwischen einander als auch Dritten gegenüber
verborgen. Das für dieses Verfahren notwendige Erfordernis der Rechtssicherheit
steuern die Terminbörsen durch ihre außer Frage stehende Integrität
bei. Terminkontraktgeschäfte in Futures
sind demnach durch Standardverträge
reglementierte, börsenmäßig (anonym) gehandelte Verfügungsrechte über
genau umrissene künftige Leistungen, für deren Erfüllung das Clearinghaus
der Börse die Verantwortlichkeit übernimmt.
Die Organisationsform des börslichen Terminhandels
bringt eine weitere, höchst wichtige Eigenheit von Futures hervor. Sie
mildert das Risiko des Versagens der entgegengesetzten Seite ganz erheblich
(Ausfallrisiko, Erfüllungsrisiko, "default risk"), das herrührt
von schlagartigen Sprüngen und übersteigerten Schwankungen der Börsenkurse
von Futures. Durch Selbsteintritt der Clearingstelle in das Vertragsverhältnis
trägt sie als unmittelbare, zentrale Vertragspartnerin der ursprünglichen
Teilhaber aller Börsentermingeschäfte zur Erfüllungssicherheit von Futures
insofern bei, als das rechnerisch überhaupt mögliche höchste Ausfallrisiko
im denkbar ungünstigsten Fall abgemindert wird allenfalls auf Verluste,
die immer nur auf Rechnung eines einzigen Handelstages zurückgingen.
Zu diesem Dienst rechnet die Clearingstelle die mit den Änderungen des
Marktpreises schwankenden Buchforderungen und Verbindlichkeiten aus
den schwebenden Terminkontraktgeschäften alltäglich auf und schreibt
die daran hängenden Gewinnsummen nach Ablauf der Börsenzeit den betreffenden
Handelskonten gut bzw. belastet diese mit den Verlustsummen. Die umschlagenden
Tagesschlusskurse der gehaltenen Futures finden damit ihre Entsprechung
in einem verschiedenen Wertstand des täglichen Kontoguthabens. Durch
eine solche auf den Marktverlauf haarklein abgestimmte Vorgangsweise
einer wechselseitigen Verrechnung und Umverteilung der aus den Kursverschiebungen
herrührenden Unterschiedsbeträge werden sämtliche der eingegangenen
Verpflichtungsgeschäfte in Futures, solange noch unvollzogen, gemäß
ihren gegenwärtigen Marktwerten börsentäglich geldmäßig zum Ausgleich
gebracht ("mark to market"-Prinzip,
Prinzip der fortlaufenden Regulierung, "periodical settlement").*
[* Das periodische
Liquidationsverfahren ist überdies auf die Abwendung der Gefahr einer
Anhäufung von Vermögensverlusten berechnet. Insoweit es dauerhaft gelingt,
diese Gefährdung wahrhaftig zum Schwinden zu bringen oder ganz abzuwenden,
verbürgt es die Sicherheit im Handel mit Futures andauernd und überhaupt.
– Vgl. für den ganzen Abschnitt auch die Betrachtungen über die
Funktion und Stellung der Clearing-Organisation ("clearing house"),
die ihr bei der Regulierung von Futuresgeschäften zufällt, insbesondere
jene über die Auswirkung des "marking to market" auf die Wertfortschreibung
von Futures-Kontrakten.]
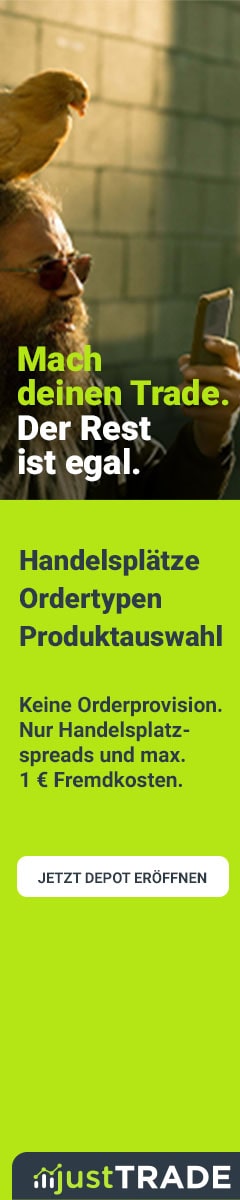
Futures sind nicht nur nach ihrem Begriffe,
sondern auch nach ihrem wirtschaftlichen Wesen ganz auf künftigen Leistungsaustausch
ausgerichtet. Dass dem so ist, bezeugt der Umstand, dass die aus dem
Abschluss von Futures-Kontrakten an der Börse hervorgehenden Rechtsansprüche
und Verpflichtungen ihrer Bewirkung durch abschließende Leistung und
Gegenleistung fast immer um einige Zeit vorauseilen. Zwar werden beide
Parteien an einem Futures sich in der Jetztzeit handelseinig über das
Tauschverhältnis, das ist die gegenseitige Verständigung auf einen Terminpreis
(Futureskurs) im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses* des Kontrakts
an der Börse, zu dem der unterliegende Handelsgegenstand ("underlying"
des Futures) später zur Übergabe und Übereignung bestimmt ist: Die Besorgung
der tatsächlichen Vertragserfüllung entweder durch effektive Lieferung,
Übernahme und Bezahlung desselben oder, falls erfordert, durch Wertausgleich
in Geld ist indes – unter Berücksichtigung der täglichen Aufrechnung
– erst zu einem festgesetzten künftigen Termin vorgesehen. Der Basisgegenstand
von Futures gelangt sohin nicht, wie bei einem "Direktgeschäft"**
üblich, gleich zur Zeit der Abmachung des Geschäfts Zug-um-Zug zum Austausch,
sondern die Erfüllung ist von vornherein auf einen rechtswirksam vereinbarten,
vorausbestimmten ferneren Zeitpunkt, den "Termin",
hinausgeschoben. Zwischen Vertragsabschluss von Futures-Geschäften an
der Börse und Erfüllung "zum
Termin" verstreichen gemeinhin mehrere Tage oder Wochen, womöglich Monate.
Eine solche über organisatorisch-technisch bedingte Erfordernisse hinausreichende
zeitliche Kluft zwischen Verpflichtungsgeschäft und Erfüllungsgeschäft
ist kernbildend nicht allein für Börsentermingeschäfte in Futures, sondern
für alle Arten von Termingeschäften ohne Ausnahme.
[* Tatsächlich
begründet der Abschluss eines Futures an der Börse überhaupt keine rechtsgültige
Abmachung zwischen den zwei initiierenden Parteien; sondern jedes Mal
in dem Zeitteilchen, wo Einigung zwischen beiden Seiten herbeigeführt
werden konnte ("matching"), schaltet sich die Clearingstelle
der Terminbörse ohne nach außen sichtbar zu werden selbstwirkend in
das Futuresgeschäft ein. Durch diesen zerlegenden Akt übernimmt sie
in identischer Stellung auch vom Rechtsstandpunkt die unmittelbare Gegenseite
der beiden ursprünglich Vertragschließenden ("novation"). Ein
unvermitteltes Band zwischen dem eigentlichen Käufer und dem eigentlichen
Verkäufer eines Futures gibt es nicht, sie stehen in keiner rechtlichen
Beziehung zueinander. Überdies deckt die Börse die eine Partei der anderen
nicht auf; sie treten nicht mit ihrer Person erkennbar hervor und verbleiben
zwischen einander, wie oben erwähnt, auf beiden Seiten vollkommen anonym.
Genau genommen gelangen immer wieder in dem Augenblick des Zustandekommens
eines Futuresgeschäftes durch das tätige Eingreifen der Clearingstelle
dafür zwei separate Vertragsbeziehungen gleichzeitig zur Entstehung,
in deren Mitte das Clearinghaus in organischer Verbindung steht. Da
nun der Ruf und das finanzielle Ansehen der Clearingstelle ebenso makellos
als unzweifelhaft erscheinen (Integrität des Clearinghauses), fällt
durch diese besondere Verfahrensweise der sonst herrschende leidige
Umstand des Bonitätsrisikos buchstäblich ganz hinweg.]
[** Das Geschäft
für prompte Lieferung (Effektivgeschäft, Bargeschäft, Tagesgeschäft,
"Direktgeschäft"; engl.: "actuals", "spot transaction",
"cash transaction") wird in der Wirtschaftssprache, sofern es
um Finanzgeschäfte geht, üblicherweise
– besonders im Börsenverkehr – mit dem Namen Kassa-, Komptant- (bzw.
Geschäft "per Kassa", Kasse(n)- oder Kontant-) oder Promptgeschäft,
bei Umsatzgeschäften mit vereinheitlichter (typisierter, physischer)
Handelsware dagegen als Spot(markt)-,
Effektiv- i. e. S. oder, insbesondere
an Warenbörsen, auch als Loko- oder Platzgeschäft ("cash contract",
"spot contract", Handel in loco) bezeichnet. Jene Zweiteilung
der Geschäftsform in Geschäfte für unverzügliche Lieferung und Zeitgeschäfte
stellt im Wesentlichen ab auf die Erfüllungszeit des Geschäfts. Die
Erfüllung übernommener vertraglicher Verpflichtungen, bei einem Kaufgeschäft
also der dingliche Vollzug des Austausches von Vertragsgegenstand gegen
Geld sowie deren gegenseitige Übereignung, erfolgt bei prompten Geschäften
in musterhafter Weise vor Ort gleich zur Zeit des Vertragsschlusses
("Lieferung gegen Zahlung jetzt", "Leistung für Gegenleistung
jetzt", Realkauf, Handkauf); in der Praxis bestimmt indes die körperhafte
Beschaffenheit des jeweiligen Handelsgegenstandes vielfach die Erfüllungsfrist
entscheidend mit: Im Falle von Börsenpapieren der Wertpapierbörsen,
wie beispielsweise den Kassageschäften in Aktien, erstreckt sich diese
– aufgrund geschichtlich alteingewurzelter, allgemein anerkannter Gebräuche
und kaufmännischer Gewohnheiten (Usancen), vorlängst auch abwicklungstechnisch-organisatorischer
Umstände halber – zumeist über zwei, manchmal mit einem Tag Zugabe bis
drei Geschäftstage hin ("Valuta zwei (drei) Tage"). In Einzelfällen
dauert die Erfüllungsfrist eines Effektivgeschäftes sogar bis zu 5 Tage,
für bestimmte ("schwimmende" oder "rollende") Waren des
Außenhandels mit Rücksicht
auf die Umschlagszeit zum Teil noch erheblich länger ("auf Lieferung
in einigen Tagen", "per einige Tage"). Bei Handelsgeschäften
in Ware gegen sofortige Kasse werden i.Allg.
alle wesentlichen Eckpunkte des Kaufvertrages in Einzelverhandlungen
für sich verhandelt, wobei die Erbringung der stipulierten Gabe und
Gegengabe i. d. R. ausdrücklich
erwünscht ist und die Effektivlieferung gewöhnlich binnen kürzester
Frist ("sofort") wahrhaftig erfolgt. Vorbedingung hierfür freilich ist,
dass der Gegenstand des Umsatzes bereits handgreiflich vorhanden ist
– was hinwieder bei solchen von Termingeschäften (Zeitgeschäften, Lieferungsgeschäften,
Kauf auf Lieferung) einstweilen nicht notwendig der Fall zu sein braucht.]
Das beigegebene Schaubild mag den dargelegten
Sachverhalt sinnenhaft anschaulich machen:

Futures werden in der fachbezogenen Sprache
nach ihrer Verpflichtungsform als zweiseitig verpflichtende, börsennotierte
"unbedingte Terminkontraktgeschäfte" ("forward commitment";
"firm commitment") bezeichnet; denn wer einen Futures-Kontrakt
abschließt, ist von Rechts wegen an die dingliche Erfüllung des Vertrags
zu dessen Erfüllungszeit persönlich gebunden, tatsächlich bestehend
solange er ein zweites, befreiendes
Gegengeschäft
vor Ablauf des Termins unterlässt. Der vorstehende Titel stellt also
allein aus sich heraus das Erfordernis der Erzwingbarkeit der wechselseitigen
Übereinkunft mit der größten Wortdeutlichkeit vor Augen. Den "unbedingten
Termingeschäften" stehen die "bedingten Termingeschäfte" (Prämiengeschäfte)
gegenüber, in deren Kreis sich die Gesamtheit der
Optionsgeschäfte einreiht.
In der Natur der letzterwähnten liegt es wieder, dass sie dem Optionsinhaber
die Befugnis einräumen, das Recht aus der Option durch einseitigen Willensakt
nach Bedarf und Belieben zur Geltung zu bringen oder es mit Ablauf der
Optionsfrist ungenutzt verstreichen zu lassen und vom verhandelten Grundgeschäft
zurückzutreten.
Der Leser beachte, dass es sich nach obiger
Lesart um eine gängige Kennzeichnung von Futures unter rein rechtlichem
Blickwinkel handelt. Aus Sicht eines
Spekulierenden (Trader)
dagegen, für den allein das Verlangen nach Bereicherung aus sich einspielenden
Preisdifferenzen Ansporn ist, lassen Futures sich durch folgende Sprachregelung
knapp und treffend kennzeichnen:
Ein
Futures repräsentiert für sich
genommen eine an der Börse nach einem vorgegebenen Muster abgeschlossene
rechtlich bindende, zeitlich genau befristete Wette auf ein Steigen
oder Fallen des Terminkurses
(Futureskurs) eines unterliegenden Wettgegenstandes. Der Wetter auf
steigende Kurse (= Käufer des Futures, Long) erhält die mit dem Kontraktumfang
des Futures malgenommene Preisdifferenz zwischen einem künftig höheren
und dem jetzigen Abschlusspreis ausgezahlt. Der Wetter auf hinabsinkende
Kurse (= Verkäufer des Futures, Short) erhält entgegengesetzt die mit
dem Kontraktumfang des Futures malgenommene Preisdifferenz zwischen
dem jetzigen Abschlusspreis und einem daraufhin sich absenkenden Preis
ausgezahlt. Mit Änderung des Terminkurses wird ein Teil an dem Wettspiel
unabweislich einen Vermögensverlust erleiden.* Dieser
verliert, was ein anderer Teil dabei gewinnt (Differenzspiel).
[* Es macht dies überhaupt das
Wettspielwesen aus, dass beide Seiten einer Wette sich verpflichten,
einen vom Ergebnis abhängigen Vermögensverlust oder sonstigen Nachteil
auf sich zu nehmen, sollte sich die vertretene Überzeugung im Nachhinein
als unzutreffend erweisen.]
Eine Verwirklichung des Wettergebnisses
ist beiden Vertragsteilen gleichermaßen bis zum letzten Handelstag des
Futures jederzeit zu den Börsenstunden durch einseitige Beendung der
Wette ermöglicht. Der Futures-Käufer (Long) macht Gewinn, wenn es ihm
während der Andauer der Wette gelingt, zu einem den Einstandskurs übersteigenden
Kurs auszusteigen, während dem Futures-Verkäufer (Short) ein Gewinn
zufällt, sowie ihm der Ausstieg zu einem unter dem Einstandskurs zurückbleibenden
Kurs zugänglich ist.
 Mit dem Depot über LYNX handeln Sie Futures ab 2,00 Euro! Jetzt Depot
über den Futures-Broker LYNX eröffnen
Mit dem Depot über LYNX handeln Sie Futures ab 2,00 Euro! Jetzt Depot
über den Futures-Broker LYNX eröffnen
Eine angestammte Eigenart des Handelsverkehrs
mit Futures liegt in seinem Aufrechnungsverfahren. Geht das Wettgeschäft
in Futures nämlich über die Tagesfrist hinaus, so gelangen immer zum
Schluss jedes neuen Börsentages sämtliche der von den Preisverschiebungen
auf dem Terminmarkt hergenommenen noch nicht verwirklichten Zwischengewinne
gemäß eindeutig festgelegten Regeln bar zur Vergütung geradeso wie alle
davon herrührenden Zwischenverluste bar zum Ausgleich zu bringen sind
(Skontration). Für die ordnungsgemäße Verteilung der Differenzbeträge
sorgt und bürgt zugleich das der Terminbörse angegliederte Clearinghaus.
Die gehaltenen Terminkontraktgeschäfte (offene
Positionen) selbst bleiben hiernach, obgleich zu Börsenschluss in
ihrem Wert jedes Mal wieder auf ihren Anfangsstand zurechtgestutzt,
unangetastet weiterhin aufrecht. Sie unterliegen nach wie vor dem Wertänderungsrisiko,
solange sie offenstehen und unvollzogen sind. Doch wonach bestimmt sich
die Höhe einer solchen wiederkehrenden Differenzenzahlung? Nun, der
erste Zahlungsbetrag, der des Tags der Positionseröffnung, bemisst sich
nach dem Abstand des im Zuge des Abschlusses der Wette auf dem Terminmarkt
des Wettgegenstandes ermittelten Referenzpreises (Einstandskurs, "agreed
price") zum festgestellten Schlusskurs ("daily settlement price")
aus jenem Handelsabschnitt. Eben dieser Schlusskurs gibt dann am darauffolgenden
Börsentage seinerseits den Maßstab ab für eine nächste Differenzzahlung
und so fort. Der jeweilige Unterschiedsbetrag wird unmittelbar nach
vollständiger Verrichtung der börsentäglichen Aufrechnung durch das
Clearinghaus denjenigen Marktteilnehmern honoriert, zu deren Gunsten
er entstanden ist. Der Gegenpartei wird dieser umgekehrt jeweils sogleich
zur Last geschrieben (vgl. Gewinn
und Verlust aus Futuresgeschäften).
Demnach liegt eine Eigentümlichkeit spekulativer
Engagements in Futures im Falle des Festhaltens an dem Kontrakt in dem
Merkmal eines von selbst sich wiederholenden Wettvertrages von je börsentäglicher
Laufdauer. Er verpflichtet beide Teile gleichermaßen, nach Vollendung
eines jeden Handelstages die durch Marktwertminderungen ausgelösten
Differenzzahlungen an die Gegenpartei zu leisten, während er sie berechtigt,
die durch Marktwertzuwächse ausgelösten Differenzzahlungen von dieser
zu kassieren. Insofern stellen Futures sich dar als börsenmäßig organisierte
Differenzspiele.
Wettverträge in Futures werden unmittelbar
angebots- und nachfragewirksam. Der Wetter auf steigende Preise ("long")
fragt Futures nach, der Wetter auf heruntergehende Preise ("short")
bietet Futures an. Mit Abschluss des Wettgeschäfts übernimmt jeder von
beiden vorübergehend ein Reisrisiko. Je nach besonderer Ausgestaltung
des Musterkontrakts, von dem die einzelne Wette hergeholt ist (den Kontraktbedingungen,
Kontraktspezifikationen), regelt sich zugleich die Art und Weise
der Übertragung von Angebot und Nachfrage auf die bezügliche Terminware
("asset class"). Man unterscheidet die auf
Realerfüllung zurechtgemachten
von den durch Barausgleich
abzuwickelnden Zukunftsverträgen. Allein bei erstgenannten tritt die
Erscheinung zutage, dass sie sich allesamt im Gewand eines gewöhnlichen
Handelskaufs auf Termin darbieten; denn sie werden auf gegenständliche
Lieferung abgeschlossen. In dieser Form umschließt die Futures-Wette
eine rechtlich durchsetzbare Verpflichtung, am Laufzeitende den Realaustausch
desjenigen Gutes, auf das die Wette als ihr unterliegender Wettgegenstand
abstellt, gegen Zahlung des letztfestgestellten Börsenpreises (Liquidationspreis)
der Sache nach vorzunehmen. Es ist dies, wie schon oben aufgezeigt,
ein von Seite der Börse nach Qualität und Quantum genau bezeichneter
Marktgegenstand, wie etwa 5000
Scheffel Weizen, 1000 Fass
Rohöl, nominal 100000€
von bestimmten Bundesanleihen, 125000
Euro gegen US-Dollar usw. es sind. Wer mit Futures dieser Klasse wettet,
muss also bei Ablauf oder auch schon ab einem ganz bestimmten Stichtag
gegen Ende der Wettfrist damit rechnen, auf Erfüllung in natura
in Anspruch genommen zu werden. Die vorgenommene Wette leitet damit
geradewegs einen gegenständlichen Handelskauf/verkauf auf Termin ein.
Längst nicht alle Arten von Futures-Wetten
bedürfen am Ende einer Naturalerfüllung. Statt einer wirklichen Überlieferung
des Wettgegenstandes verlangt heutzutage die überwiegende Mehrzahl von
ihnen von vornherein die Regulierung durch Wertausgleich (Cash Settlement,
"financial settlement"). Diese Verfahrensweise ersetzt die Effektiverfüllung
durch physische Übertragung von Gütern im Zeitpunkt der Terminfälligkeit
durch Barabgeltung, ohne dabei eine Partei gegenüber der einer tatsächlichen
Andienung finanziell schlechter zu stellen. Allein unter den börslichen
Regelsystemen, die eine materielle Form der Endabwicklung zur Vorschrift
geben, ist der Wetter auf sinkende Kurse, wenn und soweit er an seiner
Wette über eine festgelegte, auf den Schluss ihrer Laufzeit fallende
Frist hinaus festhält, zur Lieferung
und Übergabe (Verkauf des Futures = Short-Futures-Position),
der Wetter auf steigende Kurse (Kauf des Futures = Long-Futures-Position)
zur Abnahme und Bezahlung des Referenzgutes (Underlying) verpflichtet.
Bezeichnend für das Wettspielwesen, und
damit charakteristisch für den Handelsverkehr in Futures überhaupt,
ist ferner der Umstand, dass zur Durchführung der Wette selbst der körperliche
Besitz des fraglichen Verkaufsartikels für die Einleitung einer Short-Position
gerade so entbehrlich ist wie die Vorlegung der ganzen Kaufsumme für
die Einleitung einer Long-Position. Stattdessen genügt hier wie dort
die Hinterlegung einer gewissen anteiligen Summe, die als Sicherheitsmarge
genommen wird. Sonach ist jedermann, der sich dazu befähigt und berufen
wähnt, in die Lage gesetzt, durch Geldeinsatz von vergleichsweise mäßigen
Summen die Stellung eines Futures-Händlers einzunehmen und sich so an
Handelsspekulationen auf den Zukunftsmärkten zu beteiligen. Üblich für
den Einsatz, der von den Börsen als Garantieleistung vorausgesetzt und
in bar genommen wird, ist ein nur geringer Bruchteil des Gesamtwertes
des Underlying, etwa von 5 bis 20 Prozent. Je geringer sich dieser Anteil
berechnet, desto verhältnismäßig größer wird der Raum für den erreichbaren
Gewinn oder Verlust, den eine durch die Tatsachen bestätigte oder getäuschte
Überzeugung nachher einzuspielen vermag (Hebeleffekt).*
Hierdurch wird das Futuresgeschäft für beide Seiten zu einem reinen
Wettgeschäft mit gleichen Einsätzen und gleicher Ungewissheit über dessen
Ausgang.
[* Wette und Glücksspiel
("Hasard") sind streng auseinanderzuhalten. Während Wetten zu einem
gut Teil auf Kalkül, Wissen und Urteilskraft beruhen, fordern Glücksspiele
ganz bewusst nichts als die bloße Zufallsgunst heraus. Insofern lassen
sich gut untermauerte, spekulativ begründete Futuresgeschäfte wohl vergleichen
dem Abschluss einer "kohärenten" Wette, vorgenommen bspw. bei einem
ordentlichen Buchmacher (man spricht wegen des den Wetten anhängenden
Spielrisikos auch von "aleatorischen Verträgen" im Gegensatz zu Spielen
mit rein lotterieartigem Charakter, dem an sich unfruchtbaren "Glücksvertrag").
Ihm selbst lässt sich als Analogon das
Clearinghaus, das den "Wetteinsatz"
("margin")
solang entgegennimmt und verwaltet, vergleichend gegenüberstellen. Doch
aufgepasst: Anders als bei allerlei herkömmlichen Wetten ist ein möglicher
Wettverlust bei Geschäften mit Futures im Wesen der Sache von Anfang
bis zu Ende nicht auf den Wetteinsatz "margin" beschränkt, sondern kann
unter ungünstigen Marktverhältnissen mitunter weit darüber hinausgehen!]
Der Wetter in Futures ist bei alledem
in seiner Entscheidung beliebig frei. So gut er bei getäuschter Erwartung
seinen Einsatz vor der Gefahr weiteren Verlustes bewahren, so gut kann
er die mit Erfüllung der Erwartung zufallenden Gewinne im Geschäft belassen
oder sie eben mitsamt dem Wetteinsatz selbst gleich wieder aus dem Spiel
nehmen. Die außerordentlich hohe Liquidität der meisten Futures-Märkte
schafft dafür die nötige Voraussetzung. Auch einen dinglichen Güterumschlag
schon während der Wette oder bei Wettablauf hat er in Wahrheit nicht
zu besorgen. Der Wettende kann nämlich seine Wette von sich aus, wann
immer ihm daran gelegen ist, ohne sonderliche Mühe sogleich wieder beenden.
Dazu hat er nichts weiter nötig, als seiner laufenden Wette solange
diese noch andauert eine deckende umgekehrte Wette ("Gegengeschäft")
an die Seite zu stellen. Der Fortbestand des ersten Börsenwettgeschäftes
wird mit dem zweiten Geschäft, dem deckungsgleichen Realisationsgeschäft,
in der Schlusswirkung auf der ganzen Linie aufgehoben, das Futures-Geschäft
ist für ihn hiernach zu Ende. Mit der Glattstellung einher geht ein
vom Ergebnis der Marktentwicklung abhängiger Anspruch auf eine abschließende
Ausgleichszahlung, welche, wie oben dargelegt, vom verlierenden Teil
an die Clearingstelle zu leisten ist und welche der gewinnende Teil
von ihr erhält. Für die Höhe jenes letzten Zahlungsbetrages ist der
sich zum Aufhebungszeitpunkt des Futuresgeschäfts ergebende Kurswertunterschied
des Kontrakts zum Einstandskurs desselben Tages, sonst zum Vortagsschluss
maßgeblich. Die hieraus berechnete Summe wird dem zugeordneten Verrechnungskonto
des Händlers zugute gebracht bzw. zu Last geschrieben. Der durch eine
mehrtägige Wettdauer hindurch erwirtschaftete pekuniäre Gesamterfolg
der Futures-Wette stimmt, von Zinseffekten abgesehen, in der Gesamtbilanz
letzten Endes überein mit den in eine Summe zusammengezogen börsentäglich
verrechneten Einzelsalden. Hält man das Angeführte zusammen, so zeigt
sich, dass am Tagesende wie auch bei der Aufhebung des Wettgeschäfts
mit Futures (Spekulation, Trade) immer von neuem eine Ausgleichszahlung
steht, die – je nach Verlauf des Kurses – empfangen wird oder zu zahlen
ist.
Über die
Spekulation auf fallende
oder steigende Kursentwicklungen (Trading à la baisse, Trading
à la hausse) hinaus lassen sich Futures – mit dem hierzu nötigen
handelstechnischen Sachverstand – noch feiner abgestuften Zwecken nutzbar
machen, nicht zum wenigsten dem des Schutzes vor Preisänderungsrisiken
(Hedging) wie ferner auch
dem der Umsetzung einer
Arbitrage. – Dem einleitenden
Erklärungsgang zu den Grundtatsachen von Termingeschäften, ihrer ersten
einführenden Inhaltsbestimmung und der vorausgeschickten Aufstellung
der Vorbegriffe, mit denen im weiteren Verlauf umzugehen unerlässlich
ist, schließt sich in der Anordnung des Folgenden eine Erörterung von
Futures zuerst in ihren Grundzügen und in späteren Partien dann eine
ausführlichere Darstellung ihrer zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten
an. Bei gebotener Gelegenheit soll, gleichsam unterwegs, so mancher
mit dem Gegenstand in Berührung stehender Praxisfrage näher getreten
und durchaus tiefer auf Einzelheiten eingegangen werden, wobei zur Veranschaulichung
des Stoffes ausgewählte Beispiele diese Arbeit begleiten.

 Empfehlenswerte
fachwissenschaftliche Literatur über Futures und andere Derivate:
Empfehlenswerte
fachwissenschaftliche Literatur über Futures und andere Derivate:


Lesen Sie auf der folgenden Seite:
 Was sind Futures? - Ein erster Einblick in
den Handel mit Futures
Was sind Futures? - Ein erster Einblick in
den Handel mit Futures
|
Siehe auch:

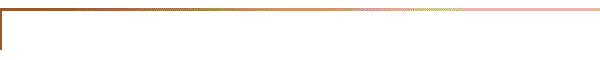
"Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht
genug, zu wollen, man muss auch tun."
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), dt. Dichter
|