|
Terminmärkte
wären ohne die Mitwirkung von
Spekulanten (Trader) kaum denkbar. Diese sorgen für die nötige Liquidität
an den Märkten und bilden überdies die Marktgegenseite für Preisabsicherer
(Hedger). Ein bezeichnendes Merkmal
für die große Mehrheit von spekulativen Aufstellungen an den Terminmärkten
ist offenbar die Kurzfristigkeit der Bindungen jede für sich. Das Zeitmaß
für ein Geschäft mit Futures
kann bisweilen äußerst kurz bemessen sein: von wenigen Augenblicken
oder einigen Minuten ("scalping") über wenige Stunden ("day-trading"),
kann es – wenngleich seltener – auch Zeiträume längerer Haltedauer durchmessen,
die sich alsdann über mehrere Tage oder gar über Wochen und Monate erstrecken
("position-trading"). Im Einzelnen lassen sich nach der Fristigkeit
ihres Erwerbsstrebens ("trade interval") nachfolgende
Gruppen von
Tradern unterscheiden:
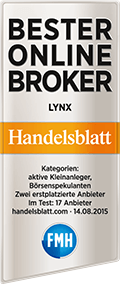
 |
Scalper
(im blumenreichen amerikanisch-populären Sprachgebrauch so viel
wie "kleiner Tagesspekulant", vom engl. "scalp", »Kopfhaut«):
Vor nicht langen Jahren handelten Scalper als geführte Mitglieder
einer Börse herkömmlicherweise berufsmäßig in eigenem Namen und
auf eigene Rechnung vor Ort auf dem Parkett der Börse ("floor
trader"). Dank ihrem Börsensitz waren sie sowohl gegenüber Außenstehenden
als auch manch anderen Preiskonkurrenten am Platze in der glücklichen
Lage einer überlegenen, weil zeitigeren Kenntnis, sei es von der
aufkommenden Stimmung, wirkenden Strömungen oder von der laufenden
Auftragslage selbst. Besonders den Letzteren gegenüber befanden
sie sich insofern in der Vorhand, als es ihnen ihre Stellung in
Verbindung mit ihrer Geschäftserfahrung ermöglichte, gewissermaßen
als "Marktinsider" maßgebliche Wissensvorsprünge* im gleichen
Augenblick ihres Eintreffens ohne Umweg ungehindert für sich umzumünzen.
Außerdem gestattete es ihre bevorrechtigte Stellung, die sonst üblichen
für die Durchführung von Börsengeschäften erhobenen Gebühren ("brokarage
fees") und Margen ("margin") einzusparen. Die betriebsamen
Scalper an den heutigen, meist elektronisch arbeitenden Börsenplätzen
setzen während der geschäftigen Börsenzeiten eine ganze Fülle von
Terminkontrakten, mitunter in gar beträchtlich großer Zahl, ohne
Unterlass in einem fort um. Dabei scheuen sie sich nicht, mit Blick
auf die allernächste Zukunft dem Markt schmalste Kursschwankungen
bis zum möglichen Mindestmaß von je 1 "tick"
herab abzutrotzen ("the edge"), um selbst den knappest bemessenen
Vorteil für sich zu haben. Das kann zuweilen soweit führen, dass
Scalper – vorwiegend unter Verhältnissen wenig überschaubaren und
hitzigen Handels – die jeweils höchsten "bids" und niedrigsten "offers"
nahezu gleichzeitig annehmen, womit sie praktisch das Amt eines
Arbitrageurs bekleiden.
Man pflegt sie in dieser Stellung mitunter als "locals" resp.
im Computerhandel allgemein auch als "independent liquidity providers"
zu bezeichnen. In Ausübung ihrer Handelstätigkeit sind sie gemeinhin
jedoch nicht geneigt, einzelne Kauf- oder Verkaufsposten davon durch
längere Zeitspannen hindurch durchzuhalten. Vermöge ihrer beständigen
Handelstätigkeiten tragen Scalper an den Derivatebörsen, ähnlich
den "market-makers"
an den Aktienbörsen, in ausgeprägter Weise zu einem Ausgleich von
Angebot und Nachfrage bei. Dadurch befördern sie zu gleicher Zeit
die Liquidität
in den Terminkontraktmärkten ("Market-Making von freien Stücken"),
was freilich allen Markteilnehmern reihum einen ersprießlichen Vorteil
zubringt.
|
[* Als Scalping
bezeichnet man nebstdem auch die (weithin verbotene) Praxis der eigenen
Positionierung in Kenntnis von richtungweisenden Marktinformationen
unmittelbar vor deren Veröffentlichung ("Insiderinformation", private
Information).]
 |
Daytrader
("intraday-trader", Tagesspekulanten) geben den Scalpern
nichts nach. Auch sie lassen sich mit der Zunft der im Eigenhandel
tätigen, auf kurz bemessene Frist Spekulierenden in Reihe und Glied
stellen (Eigenhändler, Proprehändler, "individual trader",
"aktive trader"). Nur richten Daytrader ihre Bemühungen bezeichnenderweise
mit Zielbewusstsein darauf aus, unter Inkaufnahme von zuweilen recht
großen Marktrisiken die kurzlebigen Preisbewegungen ("intraday
swings", Trends), die die gegebene "Augenblickstimmung" wirft,
noch innerhalb desselben Handelsabschnitts ("intra-day")
gewinnbringend wahrzunehmen. Sie trachten danach, selbst die kleinstmöglichen
sich aus kurzwährenden Preisschwankungen erhebenden Kursgewinne
mitzunehmen. Daytrader zeichnen sich als solche vornehmlich dadurch
aus, dass sie trotz ihrer im Allgemeinen emsigen Geschäftigkeit
nicht im Sinn haben, über das Ende eines Börsentages hinaus noch
an ihren offenen Posten festzuhalten. Sie gehen, salopp gesprochen,
täglich "glatt" von der Börse – und brauchen deshalb über Nacht
begreiflicherweise keine Vermögenseinbußen aus unvollzogen gebliebenen
Verpflichtungen mehr zu besorgen. Andererseits muss es ihnen genug
oft gelingen, ihr Tagewerk jedes Mal spätestens bis zum Handelsschluss
mit Erfolg zu vollbringen, um mit ihrem im Trading verfolgten Plan
auf Dauer bestehen zu können. Daytrader tummeln sich vorzugsweise
ebenso gerne auf den Futuresmärkten wie auf den Aktien- und Devisenmärkten.
Doch handeln sie entfernt weder in der Häufigkeit, als man dies
unter Tags bei der Gruppe der Scalper beobachten kann, noch betreiben
sie ihr Trading notwendigerweise an jedem Börsentage. Mit der Ausbildung
und Verbreitung vernetzter elektronischer Börsenhandelsplattformen
(Computerbörsen)
– und damit allgemein sinkender Handels- und Informationskosten
– verrichten Daytrader ihre Geschäfte heutzutage in zunehmendem
Maße ortsabwesend des Börsenparketts ("electronic trader").
|
[Anmerkung: Eher unter
dem Blickwinkel der "technischen Analyse" ("technical analysis")
werden jene Trader mitunter als
Swing Trader benannt, die zwar ebenfalls danach
trachten, kurzlebige, vermeintlich verheißungsvolle "chart-technische"
Trends wahrzunehmen, wobei die Haltedauer ("holding period")
der in Aussicht genommenen Position hierbei aber nicht zwingend auf
lediglich eine einzige Handelsperiode begrenzt sein muss. Streng genommen
lässt sich eine solche nicht genauer spezifizieren und kann bei Täuschung
über die Marktlage durchaus von längerer Dauer sein.]
 |
Position-Trader
(auch "long-duration trader" genannt) finden ihre Berufung
darin, die längerfristigen Trends auf den Terminmärkten nach Möglichkeit
vollständig auszumünzen, selbst solche, die sich über mehrere Tage,
Wochen, ja mitunter gar über Monate erstrecken, um auf diese Weise
die Differenzgewinne jedes ihrer Handelsgeschäfte bis zum Höchstmaß
zu steigern. Zum Einsatz kommen hierbei sowohl gewöhnliche (singuläre)
Long- oder Short-Positionen ("Outrightgeschäfte") als auch gemischte
Positionen in Form von Spreads
u.dgl. Angesichts einer
Grundausrichtung ihrer Handelsbetätigungen auf längere Hand sind
die erzielten Gewinne je vollendetem Geschäft ("round turn")
der Position-Trader im Durchschnitt naturgemäß größere als jene
der Daytrader sowohl als auch der Scalper. Von diesem Gesichtspunkt
aus spielen Handelsspesen und sonstige
Transaktionskosten für
die Gruppe der Position-Trader regelmäßig eine bloß minder bedeutsame
Rolle als für die übrigen Gruppen von Terminspekulanten. Zur Riege
der Position-Trader gehören in erster Linie Privathändler sowie
sonstige institutionelle Anleger und berufsmäßige Spieler, und diese
sind, wie man leicht gewahren kann, während ihrer täglichen Schaffenszeit
nur sehr selten persönlich vor Ort auf einem Börsenparkett anzutreffen.
|
In der
Hitze des Alltagslebens sind die Geschäftsverhältnisse an den Terminmärkten
nicht selten überaus verwickelt und vielgestaltig. Oft müssen Trader
unter vielschichtigen, in Sekundenschnelle umschlagenen Marktbedingungen
im Drange knappster Zeit Entscheidungen bisweilen von groß angelegter
Tragweite treffen. Manchmal ist ihnen durch die Hast, die den Handel
treibt, kaum ein Atemschöpfen vergönnt. So waren es noch bis vor wenigen
Jahren fast ausschließlich Personen in der Berufsstellung eines Börsenhändlers
wie auch allerlei institutionelle Teilnehmer, so nämlich bestallte Vertreter
von Banken, Hedge- und Investmentfonds, Versicherungen und sonstigen
Kapitalsammelstellen ebenso als auch die von angesehenen Industrie-
und Handelsunternehmungen, die – unterstützt durch hoch gezüchtete Handelsausstattungen
– in großem Maßstab nach bindenden Regeln mit Futures zu Werke gingen
("institutional traders"; im Eigenhandel: "proprietary traders",
"Coulissiers"). Doch hat sich das Bild vermöge der stürmischen Entwicklung
des technischen Nachrichtenwesens (IT) bei durchweg gesunkenen Börsenhandelskosten
inzwischen grundlegend gewandelt. Mit der immer weiteren Ausdehnung
der Dienste des Internets (KI, web3 usw.) und dem geballten Einsatz
der Computertechnik machen heutigentags auch andere Gesellschaftsklassen
und Berufsstände, ja selbst Kleinhändler und Privatleute ("retail
investor", "retail trader") sich in zunehmendem Maße die
Segnungen der Fortschritte der Technik zunutze und werden an den Welt-Futuresmärkten
mit Hilfe hochgezüchteter Trading-Plattformen* zu insgemein erschwinglichen
Preisen über Online-Broker
und Anbietern von Handelssoftware ("Independent Software Vendors
ISVs") ortsabwesend der Börse (dezentral) im Alleingang tätig –
und das offenbar zu ganz ebenbürtigen Geschäftsbedingungen, die sich
mit denen des Berufshändlertums durchaus messen lassen können.
[* So z.B.
das Modul J-trader von
Patsystems. J-trader, auch unter PATS bekannt, ist eine Webbrowser-kompatible
Software (Java), die im unmittelbaren Zugang auf "tick"-Basis arbeitet.
Erwähnung verdienen des Weitern bspw. X_TRADER von der Firma
Trading Technologies oder die CQG-Trading-Plattform der
CQG Inc.
Derartige dienstfertige Handelssysteme erlauben es, Terminkontrakt-
und Optionsgeschäfte bequem von jedem beliebigen vernetzten Standort
aus über das Netz durchzuführen.]
Theoretisch betrachtet lässt
sich jede vorgehaltene Position in Futures trotz von Haus aus begrenzter
Laufzeit der einzelnen Kontrakte aufrechterhalten, ohne dabei in der
zeitlichen Dauer an eine irgendwelche Schranke gebunden zu sein – allerdings
immer nur in gebrochener Linie. Um die Beibehaltung eines Postens über
die Terminfälligkeit hinaus zu bewerkstelligen, wird mit einem Doppelgeschäft,
fachgerecht eingeleitet durch eine
Switch-Order
bzw. durch einen Intra-Markt-Spread,
revolvierend der jeweils herannahende Monatstermin ("nearby")
– für gewöhnlich noch vor dem ersten Benachrichtigungstag ("first
notice day") – unter gleichzeitigem Aufrichten eines neuen Postens
gleicher Art nahtlos in einem darauf nachfolgenden
Termin glattgestellt (ein
Verfahren, das in der Leibsprache der Futures-Händler den Namen "roll-over"
oder "switching", amtlich "roll a contract forward", dt.
Reportgeschäft, führt), eine bestehende Position stets sich erneuernd
hierdurch wieder und wieder auf eine längere Zeit hinausgeschoben, also
periodisch prolongiert ("continuous contract", Prolongationsgeschäft).
Wie alle anderen Abschlüsse ("round turns") an der Börse, so
ist auch jeder "Switch" stets und ausnahmslos erkauft erstlich mit der
finanziellen Aufrechnung der bis dahin aufgelaufenen Buchgewinne bzw.
Buchverluste, und zweitens mit einer abermaligen Belastung durch Transaktionskosten,
zumal mit Brokergebühren für den erneuten Ankauf und Verkauf sowie vorkommendenfalls
mit Kosten mittelbarer Art, verursacht durch die Auswirkungen eines
"slippage"-Effekts, sofern
hierbei auf eine Spread-Order
verzichtet wird ("Rollkosten"). Manches Mal lässt sich bei der Neueinrichtung
der Futures-Geschäfte ein Kauf, abhängig von der herrschenden
Terminstruktur, stellenweise
nur zu höheren Kauf- (Report, "contango"), ein Verkauf nur zu
niedrigeren Verkaufskursen (Deport, "backwardation") als zu den
Liquidationskursen der auslaufenden Kontrakte vollziehen, was zwangsläufig
zu einer Verschlechterung der betreffenden Position führt ("Rollverluste").
Der auf den Futuresmärkten weitaus häufigere Fall ist jedoch zweifellos
die fallweise Kurswette ("trade") auf kurze Frist; zum einen
deshalb, weil eine laufende Liquiditätsbelastung aus
Nachschüssen
bei zuwiderlaufenden Kursbewegungen in Anbetracht des Hebeleffektes
finanziell gesehen einen ziemlich langen Atem erforderte, und zum anderen,
weil die Marktliquidität in den zeitlich ferner liegenden Terminen ("back
months")* nicht selten mehr als dürftig auszufallen pflegt.
[* Bedeutende Ausnahmen
davon bilden die ausgesprochen liquiden
Futuresmärkte für Geldmarktinstrumente,
besonders der SOFR-Futures und
der Eurodollar-Futuresmarkt.]
Neben
der vorhin aufgeführten, nach der Dauer ihrer Geschäftsverpflichtungen
gesonderten Einordnung von Marktteilnehmern im Terminhandel lassen sich
die Marktbeteiligten ferner nach der äußeren Gestaltung der von ihnen
eingesetzten Instrumente und Strategien rubrizieren. Nach letzterem
Unterscheidungsmerkmal seien hier nebst den Portfolio-Managern
die sogenannten Spread-Trader besonders herausgehoben. Als
Spread-Trader bezeichnet man ebenfalls spekulativ ausgerichtete
Marktteilnehmer, deren Hauptaugenmerk indes weniger den Einzelengagements
an und für sich genommen, sondern der Änderung von Kursdifferenzen
zwischen zweien oder mehreren ähnlich gearteten, gleichwohl unterschiedlich
ausgestalteten Terminmarktprodukten gilt. Der Inhaber einer Spread-Position
setzt mit Vorliebe darauf, dass vor dem Hintergrund bestehender einzel-
und gesamtwirtschaftlicher Kausalzusammenhänge die Kursnotiz des gekauften
Terminkontrakts steige und in einem Zuge damit diejenige des ihm gegenüberstehenden
verkauften Kontrakts falle, oder geradeso gut, dass die Erstere zum
Mindesten in stärkerer Proportion steige bzw. sich verhältnismäßig weniger
stark ermäßige als die Letztgenannte.
Schlussergebnis: Das gehäufte
Auftreten spekulativ tätiger Teilnehmer auf den großen Terminmärkten
bewirkt dreierlei: Es hebt und verbessert erstens die Marktliquidität
und hilft hierdurch die Leistungsfähigkeit (Effizienz) der Märkte steigern,
es fördert zweitens die Wissensaufdeckung, die für eine angemessene
Bewertung in den Termin- und Kassamärkten Voraussetzung ist (Preisermittlungsfunktion),
und ermöglicht drittens Versicherern die Überwälzung von Preisrisiken
auf die Gruppe der Spekulanten zu insgesamt fairen und marktgerechten
Preisen ("Risikoallokation").
Lesen Sie auf der folgenden Seite:
Der Futureskurs: der Börsenpreis
von unbedingten (fixen) Terminkontrakten


|